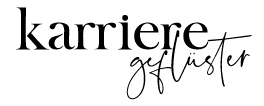Andrea König ist Soziologin, Business Mentaltrainerin und Gründerin von Karrieregeflüster.…
Transition Work beschreibt eine Arbeitsrealität, die für viele längst Alltag ist: Phasen zwischen Anstellung und Selbstständigkeit, zwischen Beruf und Care, zwischen Jobverlust und beruflicher Neuorientierung. Diese Übergänge sind keine Ausnahme mehr, sondern zunehmend struktureller Bestandteil moderner Erwerbsbiografien. Und doch fehlt es bislang an Anerkennung, Absicherung, aber vor allem an einer klaren Vorstellung davon, wie Arbeit in diesen Zwischenräumen sinnvoll gestaltet werden kann.
In diesem Beitrag geht es darum, warum Transition Work nicht nur ein individuelles, sondern ein systemisches Thema ist und was das konkret für Unternehmen und HR-Verantwortliche bedeutet. Du erfährst, wie Übergangsarbeit gesellschaftlich sichtbar gemacht werden kann, welche strukturellen Veränderungen es braucht, und wie HR konkret dazu beitragen kann, diese Phasen nicht als Lücken, sondern als wertvolle Entwicklungsräume zu gestalten.
Transition Work: Wie wir Arbeit in Übergängen neu denken müssen
Was passiert, wenn Erwerbsbiografien nicht mehr linear verlaufen, aber Systeme das noch immer erwarten? Zwischen Kündigung und Neustart, Care und Karriere, Projektarbeit und Pause klafft eine Lücke. Eine Lücke, die sich nicht nur durch fehlende soziale Absicherung auszeichnet, sondern durch das Fehlen einer gesellschaftlichen Vorstellung davon, wie sinnvolle Arbeit in der Zwischenzeit überhaupt aussehen darf.
„Transition Work“ beschreibt diese neue Realität: eine fluidere, brüchigere Arbeitswelt, in der Übergänge nicht mehr Ausnahme, sondern Normalfall sind. Doch während die Erwerbsbiografien der Menschen längst fragmentierter werden, denken viele Organisationen noch in starren Kategorien. Was heißt es, in diesen Zwischenräumen zu arbeiten und wer wird dabei sichtbar?
Zwischenräume als neue Normalität
Die Arbeitswelt verändert sich nicht nur durch Digitalisierung oder Automatisierung, sondern ganz konkret durch die Lebensrealitäten der Menschen, die in ihr tätig sind. Vor allem die Generationen X und Y erleben Arbeitsbiografien nicht mehr als durchgehende Linie, sondern als Mosaik: mal angestellt, mal selbstständig, mal in Fortbildung, mal in Care-Arbeit. Nicht selten alles gleichzeitig.
In Österreich war 2023 bereits mehr als jede dritte unselbstständig erwerbstätige Person in einem atypischen Beschäftigungsverhältnis tätig, wie etwa in Teilzeit, befristet, über Leiharbeit oder auf Basis freier Dienstverträge. Was das für HR bedeutet? Diese sogenannten „Randarbeitsformen“ sind längst in der Mitte angekommen, doch betriebliche Strukturen und HR-Systeme behandeln sie häufig noch wie Ausnahmefälle. Wer Mitarbeitende in Übergängen begleitet, statt sie in standardisierte Prozesse zu pressen, schafft langfristige Bindung und das speziell in einem Fachkräftemarkt, der sich zunehmend auf individuelle Lebensphasen einstellen muss.
Nicht der Bruch im Lebenslauf ist das Problem, sondern die Erwartung, dass es keinen geben darf.
Andrea König, Karrieregeflüster
Prekär ist nicht freiwillig und oft weiblich
Die Vorstellung, atypische Beschäftigung sei Ausdruck freiwilliger Flexibilität, hält sich hartnäckig. In Wahrheit ist sie für viele Menschen schlicht alternativlos, vor allem für Frauen. In Österreich etwa arbeitet jede zweite Frau in Teilzeit, über 40 % davon geben Betreuungs- oder Pflegeverpflichtungen als Grund an, bei Männern sind es gerade einmal 9 %. Der sogenannte „Gender Care Gap“ beträgt laut AMS täglich rund 1 Stunde und 16 Minuten mehr unbezahlte Arbeit für Frauen.
Das hat direkte Auswirkungen auf Erwerbsverläufe und auf den Handlungsspielraum von HR: Wer etwa Rückkehrgespräche nach Karenz als reines Reboarding versteht, verkennt den strukturellen Aspekt. Vielmehr geht es darum, Übergänge aktiv mitzugestalten: mit temporären Teilzeitlösungen, finanzieller Anerkennung von Pflegezeiten oder der Integration von Qualifikationsphasen. So wird Transition Work nicht zur Bruchstelle im Lebenslauf, sondern zur Phase der Weiterentwicklung.
New Work! Aber für wen eigentlich?
New Work verspricht Autonomie, Selbstverwirklichung und Flexibilität. Doch diese Konzepte sind nur so inklusiv, wie es ihre strukturellen Voraussetzungen zulassen. In vielen Unternehmen basiert New-Work-Rhetorik nach wie vor auf einem Ideal: durchgehend leistungsfähig, hochmobil, frei von externen Verpflichtungen. Wer diesem Bild nicht entspricht, etwa weil er oder sie Angehörige pflegt, nach einer Auszeit zurückkehrt oder nicht Vollzeit arbeiten kann, fällt oft aus dem Raster.
Wenn HR heute von „individueller Förderung“ spricht, dann darf das nicht nur für High Potentials gelten, sondern auch für jene, die sich in Übergängen befinden. Wer Transition Work strategisch versteht, nutzt sie als Talentplattform: Eine Person, die aus einer Projektphase kommt, bringt frische Perspektiven, aber nur, wenn sie nicht mit dem Gefühl zurückkehrt, „neu anfangen“ zu müssen. Übergänge brauchen keinen Karrierebruch, sondern Anerkennung als Kontinuität in anderer Form.
Transition Work: Zwischen Flexibilität und Verantwortung
Die Gig-Economy hat längst Eingang in den österreichischen Arbeitsmarkt gefunden und mit ihr eine Verschiebung der Risiken. Flexibilität wird oft als unternehmerische Tugend gefeiert, bedeutet in der Praxis aber häufig den Verlust kollektiver Absicherung. Laut Eurostat waren 2022 rund 14 % aller Erwerbstätigen in Österreich selbstständig, viele davon ohne ausreichende soziale Absicherung.
Hier stehen auch Unternehmen in der Verantwortung: Wer regelmäßig auf Freelancer:innen, Werkverträge oder projektbasierte Honorarkräfte setzt, darf sich nicht aus der sozialen Verantwortung stehlen. Übergangsarbeit braucht faire Honorare, transparente Verträge und idealerweise strukturelle Anschlussfähigkeit, wie etwa durch Kooperationen mit Weiterbildungsinstitutionen oder Community-Building unter temporär Beschäftigten. Gerade HR kann hier neue Standards setzen.
Fazit: Zeit für neue Arbeitsnarrative
Transition Work ist kein Nischenthema. Es betrifft Eltern, pflegende Angehörige, Soloselbstständige, chronisch kranke Menschen und in weiterer Zukunft uns alle. Wer als HR‑Verantwortliche:r heute zukunftsfähige Arbeitswelten gestalten will, muss Übergänge mitdenken: nicht als Lücke, sondern als Teil einer vollständigen Biografie. Das bedeutet: Routinen anpassen, HR‑Systeme flexibilisieren, Qualifikationsangebote modular denken, Care Arbeit sichtbar machen und biografische Vielfalt als strategischen Wert anerkennen.
What's Your Reaction?
Andrea König ist Soziologin, Business Mentaltrainerin und Gründerin von Karrieregeflüster. Sie schreibt über mentale Gesundheit, New Work mit Haltung und systemische Widersprüche in der Arbeitswelt – klar, kritisch und immer mit Fokus auf den Menschen.